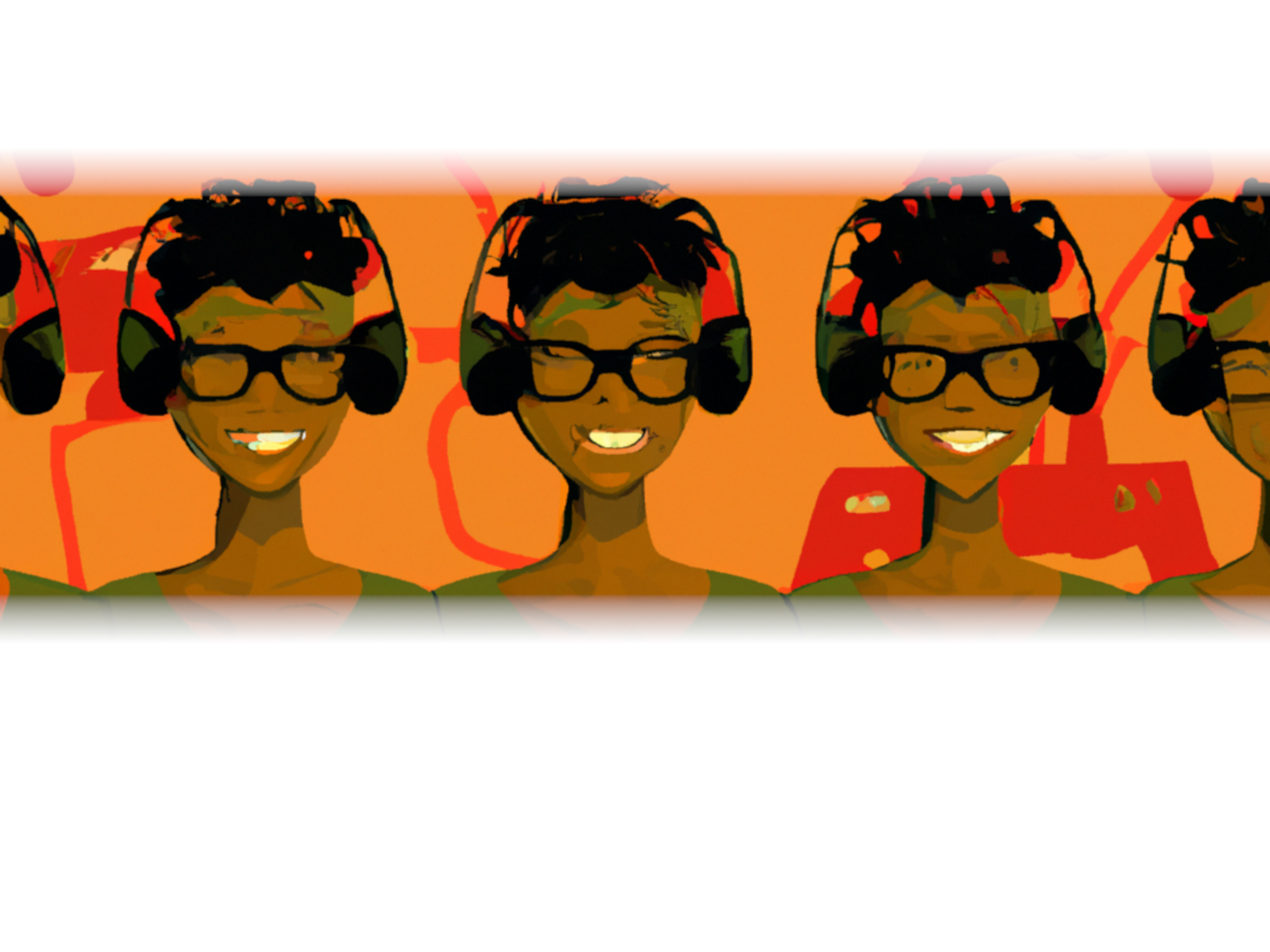Man einigt sich auf Regeln und folgt ihnen freiwillig. Punkt. Ihrer schlichten Definition nach, haben Spiele nur wenig mit den Gute-Laune-Doktrinen des Alltags zu tun. Wer Fun dennoch zur Bedingung des Spielens macht, ist ein Fundamentalist. Ein Text aus dem WASD – Bookazine für Gameskultur Nr. 12.
Fundamentalismus – mit Betonung auf den Fun – ist die unerschütterliche Forderung, dass Spiele stets Spaß machen müssen. Nicht können oder dürfen. Nein, müssen. Zwar mag es eine Tatsache sein, dass die Freude am Spielen ein sehr wahrscheinlicher Kollateralschaden ludischen Handelns ist, notwendige Bedingung für das Zustandekommen von Spiel ist sie jedoch nicht. Und genauso wenig sind Spiele, die keinen Spaß machen, einfach nur schlecht. In anderen Kulturmedien würde niemand diesen Kurzschluss wagen. Der Fundamentalist möchte eine vermeintliche Reinheit des Computerspiels bewahren, reduziert es dabei jedoch auf eine ahistorische und homogenisierte Dienstleistung. Eigentlich wie bei allen anderen Fundamentalisten – also jenen ohne Betonung auf den Fun.
Ernst
Im Ritus findet das Spiel als kulturelle Praxis eine seiner frühesten Anwendungen. Und es ist bereits dort alles andere als reiner Spaß. Das kosmische Geschehen wird in rituellen Handlungen nicht bloß dramatisiert und unernst nachgeahmt, sondern als Dromenon, als aktives Teilhaben, ist das Spielen eine unmittelbare Identifikation mit dem Kosmos. Das Bewusstsein, „nur zu spielen“, tritt hinter dem „heiligen Ernst“ zurück – wie der Kulturanthropologe Johan Huizinga schreibt. Schließlich geht es um nicht weniger als den nächsten Sonnenaufgang. Auch wenn in Game of Thrones der „trial by combat“ gefordert wird, spiegelt sich darin diese Verquickung von spielerischem Wettkampf und dem Wirken höherer Mächte.
Möglicherweise hatten die Verlierer mesoamerikanischer Ballspiele sogar Spaß, bevor sie den Göttern geopfert wurden. Aber dieser Spaß war sicher nicht das Ziel des tödlichen Rituals. Auch ein Jahrtausend später, spricht wenig dagegen, Computerspielen mit heiligem Ernst zu begegnen. Sie müssen nicht darauf festgelegt sein, die Wirklichkeit vergnüglich zu repräsentieren, sondern können ebenso die Identifikation mit existenziellen Phänomenen ermöglichen. Ein Spiel über Krieg hat es nicht nötig, Spaß zu machen, wenn darin die Erfahrung des Krieges gelungen nachvollziehbar wird. Denn Qualität bemisst sich nicht nur daran, wie spaßig die Zeit vergeht, sondern ebenso daran, dass ein besonderer Zugang zum Kosmos menschlicher Erfahrungen entsteht.
Kitsch
Wer glaubt, dass Computerspiele Spaß machen müssen, denkt sicher auch, dass Kunst schön zu sein hat. Die Kitsch-Diskussion ist ein gefährliches Pflaster, aber verstanden als ästhetische Differenzierung, ohne elitäre Agenda der Distinktion, ist sie auch für Games recht fruchtbar. So spricht gegen eine lustige Partie Overwatch ebenso wenig wie gegen betende Hände aus Bronze über dem Küchentisch. Aber es kann dennoch daran festgehalten werden, dass es neben dem Hurrakitsch eines Call of Duty und der Ornamentwut von Final Fantasy immer auch die Alternative des Spröden, Massenuntauglichen und Ernsten geben sollte. Stattdessen herrscht jedoch unter Fundamentalisten die Verwechslung von Kunst mit gelungenem und auf Spaß ausgerichtetem Interaction Design.
Selbst This War of Mine ist am Ende mehr vom fairen Balancing des Schwierigkeitsgrads geprägt als von der Realität des Krieges. In ähnlicher Weise steht der „süße Kitsch“ von The Legend of Zelda dem „sauren Kitsch“ von Journey gegenüber. „[W]enn sie die oberflächlichsten Eigenschaften des alten, süßen Kitsches in ihr Gegenteil verkehrt sehen“, so schreibt der Kunsthistoriker Curt Glaser, glauben die Bewunderer kultureller Güter plötzlich der neuen und wahren Kunst begegnet zu sein. Der Spaß bleibt im Kern des Spiels erhalten, er ist nun lediglich mit ästhetischen Irritationen und Umkehrungen gespickt. Unter diesen Bedingungen ist es auch im neuen Call of Duty: WWII keine schlaue Idee, sich dem Holocaust inhaltlich als saures Kirmeskarussell zu nähern.
Flow
Auch eine Doku über Robbenkloppen kann unterhaltsam sein. Schwer wiegt im Gaming jedoch die Reduzierung schillernder Begriffe wie Entertainment, Engagement und Fun auf das Ergebnis einer optimierten, zielorientierten Feedback-Schleife. Denn gutes Game-Design ist im Verständnis des Fundamentalisten wenig mehr als die gezielte Kriterienerfüllung für den so genannten „Flow“. Dem Psychologen Mihály Csíkszentmihályi nach, stellt sich dieses kognitive Phänomen des selbst- und zeitvergessenen Handelns meist dann ein, wenn Menschen einer klar definierten, weder über- noch unterfordernden Tätigkeit nachgehen. Das kann Autofahren, Computerspielen oder halt das Wegknüppeln von knopfäugigen Pelzviechern sein. Nur weil es angenehm ist, ist es noch lange nicht gut.
Flow ist ein schöner Zustand, aber eben ein Zustand, der Reibung und Entropie ausschließt. Träume, Rausch und komplizierte Gefühle abseits zielgerichteter Glückseligkeit haben in ihm – laut Csíkszentmihályi – keinen Platz. Als vorübergehende Unterfunktion des präfrontalen Kortex ist im Flow ausgerechnet jener Teil des Gehirns weitestgehend ruhig gestellt, der sonst über Konsequenzen und Einordnungen nachdenkt. Wer Nazis am Fließband die Köpfe wegballert, wird sich also nur schwerlich über die politische Dimension des Nationalsozialismus einen Begriff machen können. Der Spaß hört hier nicht nur sprichwörtlich auf. Flow ist ein psychologischer Hack, der weder die Komplexität und Vielfalt menschlicher Wahrnehmung noch von Games ausreichend repräsentiert.
Frust
Spaß gibt es auf Rezept, aber Frustration ergreift Spielende auf stets neue Weise. Das garantierte Vergnügen, wie es der Fundamentalist imaginiert, ist ein Akt der erfolgreichen Unterordnung unter die mechanischen Bedingungen des Spiels. Scheitern bedeutet so immer auch, sich gewollt oder ungewollt den Anforderungen der Maschine zu widersetzen und eine unabhängige Erfahrung zu machen. „Nur im Rauschen, das ist aber in der Störung, bringen Medien sich selbst in Erinnerung, rücken sie sich ins Zentrum der Wahrnehmung“, schreibt die Philosophin Sybille Krämer. Funktionierender Spielspaß wiederum versteckt die Eigenheiten eines Games, verschleiert dessen Künstlichkeit, Bedeutung und Ideologie. Ein mündiges Computerspiel muss auf Fun verzichten können.
Den rigiden Formeln der Fundamentalisten steht eine freiheitliche Designpraxis gegenüber. Mit den Schocks und Hieben der Künstler von //////////fur//// und ihrer PainStation, wird Flow mit der Erinnerung an Konsequenzen ausgetrieben. Acht Stunden ereignisloser Fahrt im Desert Bus eignen sich nicht für einen Joyride, aber wohl für die Ritualisierung als Charity-Event. Nur der Kitsch mag nicht verschwinden. So wie in der Filmindustrie unlustige Funny Games möglich sind, muss auch in der Spielindustrie eine gesunde Nische für schwer zumutbares entstehen. Doch wo sich Michael Haneke problemlos wünschen kann, dass das Kinopublikum frühzeitig den Saal verlässt, sind selbst radikale Spielentwickler auf das finanzielle Wohlwollen fundamentalistischer Gamer angewiesen.
Es kann nicht darum gehen, den Spaß auszulöschen, sondern schlicht darum, Alternativen zu ermöglichen und zu erproben. Computerspiele wären nicht das erste Medium, das es von einer Jahrmarktsattraktion zum Reichtum der Strömungen und Subkulturen gebracht hat. Der Fundamentalismus hingegen ist eine Weigerung des Heranwachsens, ein stures Verharren im Status Quo. Dass sich der Rest der Kultur gefälligst mit Computerspielen im aktuellen Zustand abzufinden hat, ist dabei nur die halbe Wahrheit. Denn der größte Schritt zum vollumfänglichen Kulturgut steht Games erst noch bevor: Sie können das ganze Spektrum menschlicher Erfahrungen abbilden, ohne das nur „50 Shades of Fun“ dabei herauskommen. Immer nur Spaß haben, macht auf Dauer eben auch keinen Spaß mehr.
Christian Huberts hat großen Spaß daran, keinen Spaß zu haben. Ein ähnliches Erlebnis verspricht auch sein Blog: www.schauanblog.de.